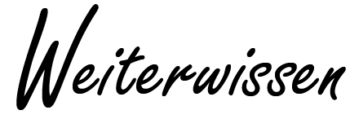Seit einigen Jahren forscht und doziert Prof. Dr. Andrea Kobleder an der OST im Fachgebiet der Palliative Care. Im Interview spricht sie darüber, woran es im Gesundheitssystem noch hakt und wie Gesundheitsfachpersonen dazu beitragen können, die Lebensqualität unheilbar kranker und sterbender Menschen zu verbessern.
Interview:
Sie setzen sich als Forscherin und Professorin intensiv mit Palliative Care auseinander. Was fasziniert Sie daran?

Die Palliative Care ist für mich deswegen so spannend, weil sie nicht allein auf die Erkrankung fokussiert, sondern den Menschen und sein Umfeld ganzheitlich betrachtet. Was im Zentrum steht, ist die Lebensqualität der einzelnen Person. Für mich ist das ein bedeutender Ansatz in der medizinischen und pflegerischen Versorgung.
Mit der Lebenserwartung steigt auch die Zahl an älteren, chronisch kranken Patientinnen und Patienten. Was bedeutet das für die Pflege im Allgemeinen und die Palliative Care im Besonderen?
Unser Gesundheitssystem ist vor allem auf die akute stationäre Betreuung und Behandlung ausgerichtet. Dieser «Spitalfokus» wird auf Dauer nicht funktionieren. Es bedarf eines massiven Ausbaus des häuslichen und ambulanten Betreuungssettings. Zudem ist es wichtig, dass die informelle Pflege, die von Angehörigen oder Freiwilligen geleistet wird, mehr Beachtung und Wertschätzung erfährt. Auf professioneller Ebene gilt es, Leistungen im palliativen Bereich abrechenbar zu machen und Fachpersonen ein umfangreicheres Wissen sowie zusätzliche Kompetenzen zu vermitteln.
Welches Wissen müssen Fachkräfte mitbringen, um Personen in palliativen Situationen professionell zu betreuen?
Unabdingbar ist ein vertieftes Fachwissen rund um Symptommanagement. Dabei geht es um den richtigen Einsatz pharmakologischer, nicht-pharmakologischer, pflegerischer sowie interprofessioneller Interventionen für die betroffene Person. Dies unter stetiger Berücksichtigung und Integration ihres sozialen Umfelds. Symptome beziehen sich aber nicht nur auf die rein körperliche, sondern auch auf die psychische, soziale und spirituelle Ebene. Deshalb ist das Wissen aus Bezugsdisziplinen wie der Psychologie oder Soziologie ebenso bedeutsam. Eine grosse Rolle spielen auch interprofessionelle sowie interkulturelle Kompetenzen. In unseren Weiterbildungen streue ich daher bewusst Themen ein, die nicht primär etwas mit Palliative Care zu tun haben. Kürzlich unterrichtete eine Dozentin zum Thema Gendermedizin.
Wo sehen Sie Forschungsbedarf im Bereich der Palliative Care?
Betroffene Personen und ihr soziales Umfeld haben besondere Bedürfnisse und Erfahrungen. Dazu müssen wir noch mehr Wissen generieren und darauf aufbauend evidenzbasierte interprofessionelle Interventionen entwickeln und testen. Im Bereich der Palliative Care sind wir allerdings mit der besonderen Herausforderung konfrontiert, Betroffene zu finden, die bereit sind, an einem Forschungsprojekt teilzunehmen. Dies muss uns bewusst sein. Es braucht die Offenheit, von «klassischen» Wegen in der Forschung abzuweichen.
Die nationale Strategie zielt darauf ab, der Bevölkerung flächendeckend Zugang zu Versorgungsplätzen zu gewähren. Wie nah ist man an diesem Ziel?
In den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung stattgefunden. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass Sterben, Tod und Trauer in der Gesellschaft lange Tabuthemen waren. Trotzdem gibt es noch Lücken in der flächendeckenden Versorgung mit Palliativ-Care-Angeboten. Was mich aber immer wieder motiviert ist, dass unsere Studierenden ihr Wissen in die Praxis einbringen und die Möglichkeit nutzen, diese zugunsten Betroffener mitzugestalten.
Zur Person
Prof. Dr. Andrea Kobleder ist seit 2013 am IPW Institut für Angewandte Pflegewissenschaft der OST – Ostschweizer Fachhochschule tätig. Sie wirkt in verschiedenen nationalen und internationalen Projekten mit. Ihre Expertise in den Themengebieten Onkologische Pflege, Palliative Care und Advanced Practice Nursing bringt sie als Dozentin in die Lehre und Weiterbildung ein. Seit 2018 leitet Andrea Kobleder den MAS in Palliative Care.