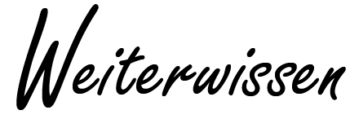Die Digitalisierung schreitet voran, auch im Gesundheitswesen. Samuel Peters ist Medizinphysiker und arbeitet seit 15 Jahren in der radio-onkologischen Klinik am Kantonsspital St. Gallen (KSSG). Im Rahmen seiner Masterarbeit in Business Information Management hat der 42-jährige Amriswiler die Möglichkeiten und Grenzen einer durchgängigen Digitalisierung in der Radio-Onkologie aufgezeigt. Im Interview sagt er, was der Mehrwert einer Umstellung auf einen rein digitalen Arbeitsalltag ist und ob dadurch auch die Behandlungen wirksamer werden.
Von Marion Loher
Sie arbeiten als Medizinphysiker. Ein Beruf, den man nicht oft hört. Was machen Sie genau?
In jeder radio-onkologischen Abteilung eines Spitals gibt es pro Bestrahlungsgerät mindestens einen Physiker. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Wir tragen einerseits die Verantwortung für dieses Gerät, schauen, dass es richtig funktioniert und die Qualität stimmt. Andererseits berechnen wir gemäss Verordnung des Arztes oder der Ärztin die Dosis, mit welcher Krebspatientinnen und -patienten bestrahlt werden. Wir sind zudem für den Strahlenschutz und die bestrahlungsbezogenen IT-Systeme zuständig.

«Dass sich mit der Digitalisierung auch die Heilungschancen erhöhen, wäre natürlich das Beste. Noch sind wir aber nicht so weit.»
Samuel Peters, Leiter Radio-Onkologie Informatik, Medizinphysiker (SGSMP) Klinik für Radio-Onkologie
Wie sind Sie als studierter Physiker zur Medizin gekommen?
Das Interesse für die Medizin ist bei mir während des Physikstudiums entstanden. Nach Abschluss des Studiums habe ich eine dreijährige Ausbildung zum zertifizierten Medizinphysiker in der radio-onkologischen Klinik des Kantonsspitals St. Gallen gemacht. Das war vor 15 Jahren. Seither arbeite ich dort.
Sie haben vergangenes Jahr den Studiengang MAS Business Information Management absolviert. In Ihrer Masterarbeit zeigen Sie die Möglichkeiten und Grenzen einer durchgängigen Digitalisierung einer radio-onkologischen Klinik auf. Was ist diesbezüglich heute möglich?
Vieles. Ich habe für meine Arbeit in unserer Klinik einen vollständigen Arbeitsprozess analysiert; von der Begrüssung und Aufnahme des Patienten über die verschiedenen Voruntersuchungen bis hin zur Strahlentherapie. Insgesamt sind es über 130 Teil-Arbeitsschritte, die von verschiedenen Personen wahrgenommen werden. 80 Prozent dieser Arbeitsschritte, bei denen die Patientinnen und Patienten nicht dabei sind, sind komplett digital, aber nicht unbedingt automatisiert. In meinen Augen heisst digitalisieren auch automatisieren und vernetzen. Bei uns sind höchstens ein Viertel der Arbeitsschritte auch automatisiert. Der Rest läuft manuell. Gerade im Bereich der Strahlendosis-Berechnung kann vieles automatisiert werden, beispielsweise durch die Unterstützung von künstlicher Intelligenz.
Wo sind die Grenzen einer durchgängigen Digitalisierung?
Überall dort, wo der Mensch unmittelbar involviert ist, wie beim Aufklärungsgespräch oder bei der Patientenlagerung am Bestrahlungsgerät, ist digitalisierte Arbeit schwierig. Die meisten Patientinnen und Patienten brauchen dieses Zwischenmenschliche und fühlen sich unwohl, wenn der Arzt beispielsweise beim Aufklärungsgespräch nur in den Computer schaut. Aber es gibt mittlerweile auch digitale Technologien, die uns bei den patientennahen Arbeiten unterstützen, wie der Gesichtsscanner oder der Fingerprint. Uns fehlt aber insgesamt ein digitaler Standard, um Daten weiterverarbeiten oder mit anderen Kliniken austauschen zu können.
Unter Ihrer Führung wurde 2019 in der radio-onkologischen Klinik am KSSG die papierbasierte Patientenakte durch einen vollständig elektronischen Ablauf ersetzt. Was waren damals die grossen Herausforderungen?
Da gab es vor allem zwei Punkte. Zum einen waren es sehr alte Prozesse, die wir analysierten. Wir wollten diese von Grund auf optimieren, also auch weglassen, was nicht mehr nötig war. Und bei über 130 Teil-Arbeitsschritten war es nicht einfach, das Ganze im Auge zu haben, da die meisten Mitarbeitenden nur bei ihrem Teil involviert sind. Der Überblick fehlte. Zum anderen war es eine Herausforderung, Personen, die schon seit vielen Jahren in der radio-onkologischen Klink arbeiten, vom Vorteil einer durchgängigen Digitalisierung und einer standardisierten Arbeitsweise zu überzeugen. Da hat es zum Teil Widerstand gegeben, der manchmal heute noch spürbar ist. Aber das ist normal, denn nicht alle Menschen können mit den neuen Technologien gleich viel anfangen.
Was ist der Mehrwert einer Umstellung auf einen rein digitalen Arbeitsalltag in einer radio-onkologischen Klinik?
Es geht darum, effizienter und effektiver zu arbeiten. Wir haben viele einzelne Arbeitsschritte und viele Mitarbeitenden, die zum Teil interdisziplinär zusammenarbeiten. Da hilft uns das Digitale sehr, den Überblick zu behalten und koordiniert vorzugehen. Früher gab es für jede Patientin und jeden Patenten einen physischen Aktenordner. Heute sind alle Patientendaten digital abgelegt und sofort von überall abrufbar. Das ist enorm zeitsparend. Früher war es auch schon vorgekommen, dass man den Ordner eines Patienten oder einer Patientin nicht fand und man herumfragen musste. Das kann heute nicht mehr passieren. Alle Mitarbeitenden wissen, wo die entsprechenden Daten sind und wo wir im Behandlungsprozess stehen. Wir haben heute mehr Zeit für unser Kernbusiness, die Behandlung und Betreuung des Menschen, und müssen keine Zeit mehr fürs Aktensuchen aufwenden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Transparenz und Konsistenz der Behandlungsabläufe: Durch die digitale Datenerfassung ist jederzeit klar, wer welchen Schritt vollzogen hat. Durch die elektronischen Abläufe ist so auch sichergestellt, dass die Behandlungen immer nach dem gleichen Muster ablaufen. Das bedeutet eine deutliche Qualitätsverbesserung und gibt Sicherheit. Vor der Umstellung war dies nicht immer gegeben.
Wird tatsächlich besser gearbeitet, wenn alles digital läuft?
Ich bin ein grosser Fan der Digitalisierung. Dennoch ist etwas nicht einfach besser, weil es digital ist. Wir haben beispielsweise gemerkt, dass die Ärztinnen und Ärzte bei den elektronischen Patientengesprächen viel weniger Persönliches von den Patientinnen und Patienten notieren, da sie anhand vorgegebener Fragen das Formular ausfüllen. Hier geht das Zwischenmenschliche etwas verloren. Trotzdem nimmt die Effizienz mit der Digitalisierung stark zu. Ein Beispiel ist der Patientenbrief. Bisher hat es durchschnittlich sieben Tage gedauert, bis der Brief, der zunächst vom Arzt diktiert, dann von der Fachperson geschrieben und überarbeitet wurde, abgeschickt werden konnte. Mit der automatischen Spracherkennung, wie wir sie heute haben, schaffen wir es in weniger als drei Tagen, den Brief versandfertig zu machen. Das ist eine deutliche Effizienzsteigerung.
Werden auch die Behandlungen effektiver und wirksamer, wenn alle Arbeitsabläufe elektronisch sind?
Dass sich mit der Digitalisierung auch die Heilungschancen erhöhen, wäre natürlich das Beste. Es ist ein grosses Ziel. Noch sind wir aber nicht so weit. Nur durch rein elektronische Arbeitsabläufe ändert sich grundsätzlich nicht viel an der Wirksamkeit der Behandlungen. Wenn die Kliniken – sowohl national als auch international – aber einen guten elektronischen Datenstamm haben, kann viel mehr klinikübergreifend gearbeitet werden. Es könnten Daten ausgetauscht und verglichen werden. Durch einen effizienteren Austausch wäre es möglich, bessere Therapiemöglichkeiten für die Patientinnen und Patienten zu bekommen. Diesbezüglich gibt es auch Bestrebungen, wie die Verwendung von künstlicher Intelligenz, die dem Arzt oder der Ärztin hilft, die bestmögliche Therapie für den Patienten zu finden. Hier steckt noch viel Potenzial. Wir bleiben dran.